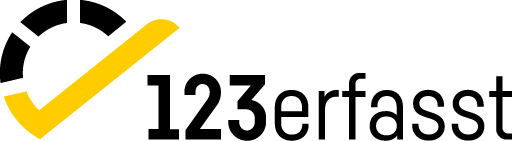Schlechtwetter am Bau muss kein Hindernis sein! Hier erfährst du, worauf du beim Bauen im Winter achten solltest und wie du Sturm und Regen auf der Baustelle sicher überstehst.
Richtig handeln bei Schlechtwetter auf der Baustelle
Schlechtwetter auf dem Bau bringt spezifische Herausforderungen mit sich, von witterungsbedingten Arbeitsausfällen bis hin zur Sicherheit der Beschäftigten. Im Folgenden erfährst du, was es mit der Schlechtwetterzeit auf sich hat und was du in diesem Zeitraum beachten solltest.
Was ist die Schlechtwetterzeit auf dem Bau?
Die Schlechtwetterzeit im Baugewerbe ist ein tariflich oder gesetzlich festgelegter Zeitraum, in dem witterungsbedingt mit Arbeitseinschränkungen zu rechnen ist. Der Schlechtwetterzeitraum dauert drei Monate und beginnt gemäß Sozialgesetzbuch (§ 101 Abs. 1 SGB III) am 01.12. eines jeden Jahres und endet am 31.03. des Folgejahres.
Die Schlechtwetterzeit wurde eingeführt, um saisonale Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee, Kälte oder Sturm zu berücksichtigen. Schlechtwetter erschwert die Arbeit auf dem Bau maßgeblich und macht sie teilweise unmöglich. Damit die Bauarbeiten trotzdem gut ausgeführt werden können, muss Schlechtwetter bereits bei der Planung berücksichtigt und einkalkuliert werden. Darüber hinaus ist während der Schlechtwetterzeit ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der am Bau Beschäftigten zu richten.
Was gilt in der Schlechtwetterzeit am Bau?
Während des Schlechtwetterzeitraums am Bau gelten spezielle Regelungen für den Baulohn, sodass Arbeitnehmer auch bei witterungsbedingten Arbeitsausfällen finanziell abgesichert sind. Kommt es aufgrund von Schlechtwetter am Bau wie starkem Regen oder Schnee zu Arbeitsmangel oder Arbeitsausfällen, besteht die Möglichkeit, Saison-Kurzarbeitergeld (Saison KUG) zu beantragen. Um dieses Schlechtwettergeld zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Arbeitnehmer müssen in einem Betrieb beschäftigt sein, der dem Baugewerbe angehört oder in einem Wirtschaftszweig, der von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist (§ 101 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).
- Der Arbeitsausfall muss nach den gesetzlichen Bestimmungen als erheblich gelten (§ 101 Abs. 1 Nr. 2 SGB III).
- Im Betrieb muss mindestens eine Person beschäftigt sein (§ 97 SGB III).
- Die Arbeitnehmer müssen eine versicherungspflichtige Beschäftigung haben, das Arbeitsverhältnis darf nicht gekündigt oder aufgelöst sein, und sie dürfen nicht vom Kurzarbeitergeld ausgeschlossen sein (§ 98 SGB III).
Für die Beantragung des Saison KUG bei der Agentur für Arbeit ist der Arbeitgeber verantwortlich. Die Höhe des Saison KUG richtet sich danach, wie viel Nettolohn durch die Kurzarbeit entfällt. Grundsätzlich erhalten Beschäftigte 60 Prozent des eigentlichen Nettolohnes. Befindet sich ein Kind im Haushalt steigt dieser Prozentsatz auf 67 Prozent.
Neben dem Saison KUG können auch weitere Leistungen wie das Mehraufwand-Wintergeld, das Zuschuss-Wintergeld oder die Erstattung von Sozialleistungen bei der zuständigen Arbeitsagentur beantragt werden. So wird garantiert, dass die Arbeitnehmer auch im Schlechtwetterzeitraum einen Teil Ihres Baulohnes erhalten.
Tipp: Mit unserer 123erfasst-App für den Baulohn können deine Mitarbeitenden ihre Arbeitszeiten ganz einfach erfassen und unser System übergibt alle Daten direkt von der Baustelle an deine Lohnabrechnung.
Bauen im Winter: Das solltest du bei Kälte auf der Baustelle beachten
Beim Bauen im Winter sind einige Besonderheiten zu beachten. Zwar kann grundsätzlich auch in der kalten Jahreszeit gebaut werden, allerdings beeinflusst die Kälte auf der Baustelle sowohl die verwendeten Baustoffe als auch die Arbeitsabläufe. Das bedeutet, dass Baustellen im Winter in der Regel länger dauern und wirtschaftlich weniger rentabel sind. Es ist daher ratsam, mögliche Bauverzögerungen in die Planung und Kalkulation einzubeziehen, um auf die Herausforderungen des Winters vorbereitet zu sein.
Die 5-Grad-Grenze
Solange die Temperaturen über fünf Grad liegen, ist es meist problemlos möglich, beispielsweise ein Haus im Winter zu bauen. Sinken die Temperaturen jedoch unter fünf Grad, ist Vorsicht geboten. Denn bei besonders kalten Temperaturen verändern sich viele chemische Baustoffe und können dann nicht mehr wie gewohnt verwendet werden.
Vor allem wasserbasierte Baustoffe wie Beton, Farbe, Putz oder Mörtel reagieren empfindlich auf Frost und können bei Temperaturen unter fünf Grad nicht richtig aushärten. Das führt nicht nur zu Verzögerungen auf der Baustelle, sondern kann auch die Statik des Hauses gefährden.
Arbeitssicherheit auf der Baustelle im Winter
Bauen im Winter stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, daher sind Arbeitsschutz und Unterweisung auf der Baustelle gerade in der kalten Jahreszeit von besonderer Bedeutung. Im Winter können verschiedene Gefahren auftreten, die sowohl das Personal als auch den Bauprozess gefährden. Dazu zählen Glätte durch Eis und Schnee, schlechte Sichtverhältnisse durch Regen und Dunkelheit sowie veränderte Eigenschaften von Maschinen und Baumaterialien durch Kälte auf der Baustelle.

Haus im Winter bauen: Besondere Herausforderungen bei Material und Sicherheit.
Um deine Baustelle im Winter so sicher wie möglich zu machen, solltest du bestimmte Vorkehrungen treffen. Mit diesen fünf Tipps minimierst du das Unfallrisiko und trotzt dem Schlechtwetter am Bau:
- Beleuchtung:
Verbessere die Beleuchtung auf der Baustelle, um die Sichtverhältnisse auch bei früh einsetzender Dunkelheit zu optimieren. - Streupflicht:
Bestreue glatte Flächen mit Salz oder Sand, um die Rutschgefahr bei Eis und Schnee zu verringern. - Heizung:
Heize deine Baustelle im Winter mit mobilen Heizgeräten, um das Wohlbefinden deiner Mitarbeitenden zu steigern und ihnen das Arbeiten zu erleichtern. - Wartung:
Überprüfe und warte Maschinen und Werkzeuge regelmäßig, da sie bei Kälte anders reagieren können. - Schutzmaßnahmen:
Nutze wetterfeste Planen und temporäre Schutzkonstruktionen, um Arbeitsbereiche und empfindliche Baumaterialien vor Schneefall und Regen auf dem Bau abzusichern.
Unwetter im Anmarsch: Dein Baustellen-Plan für Extremwetter
Kälte ist jedoch nicht das einzige Risiko auf der Baustelle. Auch andere Witterungsbedingungen bergen Gefahren für die Mitarbeitenden und das Bauvorhaben. Zu den typischen Schlechtwetter-Phänomenen zählen:
- Regen auf dem Bau:
Vor allem Starkregen kann zu rutschigen Oberflächen führen, was die Gefahr erhöht, auszurutschen oder zu stürzen. - Gewitter auf der Baustelle:
Hier besteht die Gefahr von Blitzeinschlägen, was besonders bei Arbeiten in der Höhe oder mit Metallkonstruktionen gefährlich ist. - Sturm auf dem Bau:
Starke Winde können Baumaterialien und Geräte umherwehen und so Schäden verursachen oder Mitarbeitende gefährden.

Der Bau ruht, der Regen nicht – Schlamm und Pfützen, ein gefährliches Terrain.
Durch geeignete Prävention kannst du diese Gefahren in den Griff bekommen. Nutze Wettervorhersagen, um vorausschauend zu handeln und eventuelle Schäden zu verhindern. Wenn Starkregen vorhergesagt wird oder sich ein Unwetter ankündigt, kannst du deine Baustelle schützen, indem du lose Materialien und Geräte sicherst sowie Überdachungen errichtest. Darüber hinaus solltest du dich über den Versicherungsschutz für deine Baustelle informieren.
Ebenso wichtig ist die Beachtung gesetzlicher Vorgaben: Laut Arbeitsschutzgesetz (§ 3 Abs. 1 ArbSchG) sind Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Beschäftigten zu ergreifen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Schutzkleidung für den Fall, dass es stark regnet oder besonders kalt ist.
Neben Schutzkleidung ist auch ein Ort, an dem sich die Bauarbeiter umziehen und aufwärmen können – etwa ein beheizbarer Container oder Bauwagen – essenziell, um die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle den Witterungsbedingungen anzupassen und die Sicherheit sowie das Wohlbefinden der Beschäftigten zu gewährleisten.
Achtung: Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kann es bei extremen Witterungsbedingungen notwendig sein, die Arbeiten auf der Baustelle zu unterbrechen oder einzustellen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.
Fazit: Diese Möglichkeiten hast du bei Schlechtwetter am Bau
Extremwetter am Bau betrifft nicht nur das Bauen im Winter, auch das Bauen im Sommer oder starker Regen auf dem Bau kann für alle Beteiligten sehr belastend sein. Bei Schlechtwetter auf der Baustelle – seien es Temperaturen unter fünf Grad oder orkanartiger Sturm – hast du als Bauherr folgende Handlungsmöglichkeiten, um deine Mitarbeitenden zu schützen:
- Passe die Arbeits- und Pausenzeiten an. Arbeiten können auch am frühen Morgen oder am späten Abend mit mehreren kürzeren Pausen verrichtet werden.
- Möchte ein Mitarbeitender wegen der Kälte oder des Regens nicht weiterarbeiten, so versuche ihn an einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen, an dem es wärmer bzw. trocken ist.
- Sind die extremen Witterungsbedingungen nur von kurzer Dauer, kannst du deinen Arbeitskräften auch nur einige Stunden „regenfrei“ gewähren.
In der Baubranche ist es außerdem üblich, dass die auf Gleitzeitkonten angesammelten Überstunden bei extremen Witterungsverhältnissen ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass die Bauarbeiter zwei oder drei Stunden früher gehen können, ohne dass für dich als Arbeitgeber ein wirtschaftlicher Nachteil entsteht.
Mit der mobilen Zeiterfassung von 123erfasst behältst du auch bei wechselnden Wetterbedingungen und flexiblen Arbeitszeiten den Überblick. Die benutzerfreundliche Lösung hilft dir, die Arbeitszeiten deiner Mitarbeiter effizient zu erfassen und zu verwalten – selbst bei schnell wechselnden Bedingungen. Probiere es aus und profitiere von den zahlreichen Vorteilen der intelligenten Bausoftware.
Bildnachweise: Bild 1 © Enrique del Barrio/stock.adobe.com; Bild 2 © Fotolyse/stock.adobe.com; Bild 3 ©Superingo/stock.adobe.com